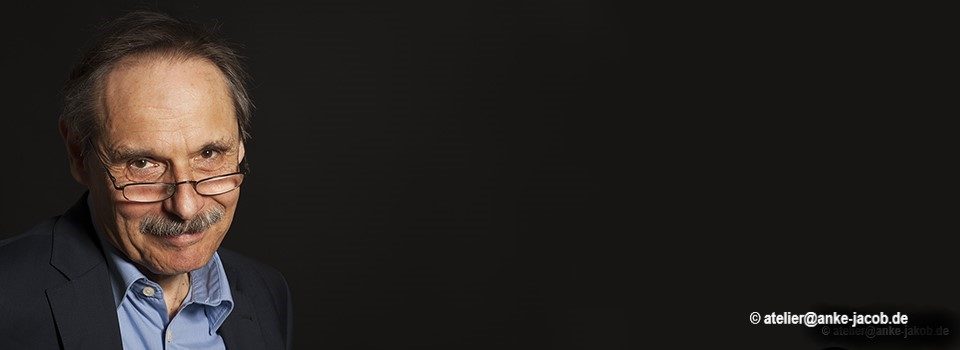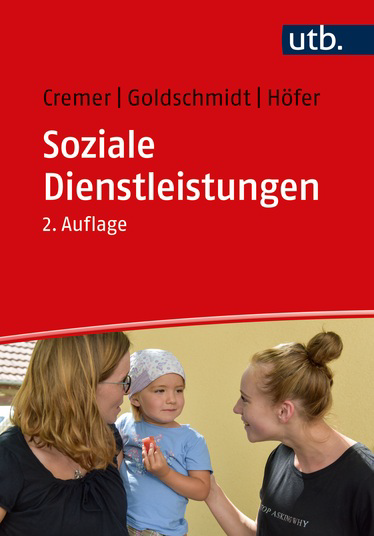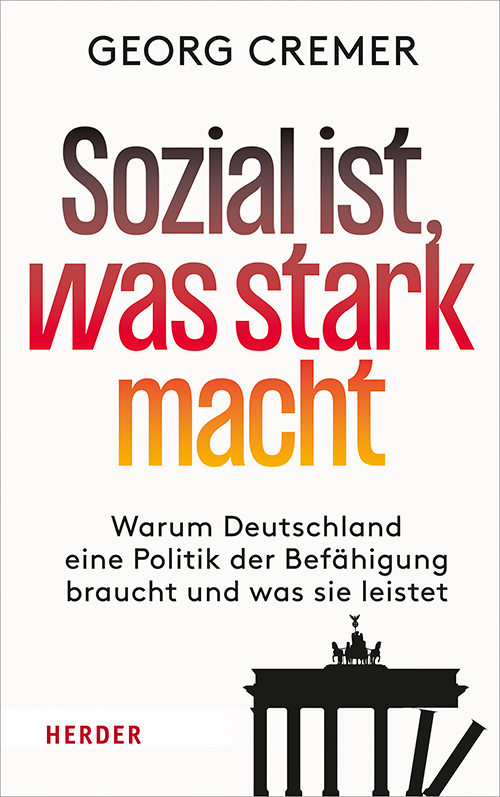Gastkommentar auf ZEIT ONLINE 04.06.2024
Übersicht über alle Texte https://www.zeit.de/autoren/C/Georg_Cremer/index
Bringschuld, Holschuld, Eigenverantwortung: Die Ampel streitet über die Balance von staatlicher Fürsorge und Selbstverantwortung. Eine Debatte ohne Schlagworte wäre gut.
In der verfahrenen Auseinandersetzung um die Kindergrundsicherung verteidigt Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) ihr Vorhaben mit dem Argument, die "Holschuld der Bürger" müsse durch eine "Bringschuld des Staates" abgelöst werden. Ihr mächtigster Gegenspieler, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), kontert: Diese Vorstellung sei "verstörend", der Staat solle die Menschen nicht von Eigenverantwortung entwöhnen. Lindners Kabinettskollege, Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), wird zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes grundsätzlich: "Paternalismus kann sich nicht auf das Grundgesetz berufen." Und in einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fordert die Journalistin Katja Gelinsky, nicht nur die Kindergrundsicherung aufzugeben, sondern gleich das ganze Familienministerium abzuschaffen. "Familien brauchen kein Nanny-Ministerium, sondern eine kluge Wirtschafts- und Finanzpolitik."
Abseits des plakativen Schlagabtauschs wäre eine konzeptionelle Debatte durchaus hilfreich. Verdrängt der Sozialstaat die Eigenverantwortung? Wie fürsorglich oder gar paternalistisch darf oder muss staatliche Sozialpolitik sein?
Der Staat ist kein Lieferservice
Das Bild von der Bringschuld des Staates, das Paus in die Debatte gebracht hat, ist durchaus schräg. Wer telefonisch eine Pizza nach Hause bestellt, vereinbart zugleich, dass die Pizzeria die Bringschuld hat. Der Staat ist aber kein Lieferservice. Andererseits aber fördert es nicht die Eigenverantwortung, auf die Lindner pocht, wenn Hürden beim Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen gerade von denen nicht überwunden werden können, die am dringendsten auf Hilfen angewiesen sind. Es bedeutet keine "Entwöhnung" von Eigenverantwortung, wenn der Sozialstaat bürgerfreundlicher wird.
Eigenverantwortung ist zu einem Schlagwort geworden. Unbestreitbar gibt es eine problematische Verwendung des Topos der Eigenverantwortung, wenn damit Kürzungen von Sozialleistungen legitimiert werden sollen, ohne dass plausibel begründet werden kann, wie dies den Raum für Selbstsorge und Prävention erweitern kann. Es wäre dann ehrlicher, Kürzungen mit der Notwendigkeit zu begründen, öffentliche Haushalte zu konsolidieren, was notge-drungen auch zur Aufgabe von Politikerinnen und Politikern gehört.
Ohne Eigenverantwortung ist kein Sozialstaat zu machen
Viele jener, die sich für einen starken Sozialstaat einsetzen, reagieren reflexhaft auf den möglichen Missbrauch des Topos der Eigenverantwortung und rücken ihn in eine neoliberale Ecke. Er stehe für den Rückzug des Staates und die Individualisierung sozialer Notlagen. Aber selbstredend ist ohne die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger kein Staat zu machen, auch kein Sozialstaat.
Die entscheidende Frage ist: Leisten das Bildungs- und Sozialsystem das Mögliche, damit Menschen ihre Potenziale entfalten können, um überhaupt eigenverantwortlich handeln zu können? Aus diesem Blickwinkel zeigt sich, dass viele Familien eben mehr brauchen als eine kluge Wirtschafts- und Finanzpolitik. Die beste Wirtschafts- und Finanzpolitik kann nicht verhindern, dass es Familien gibt, deren Kinder nicht stark ins Leben starten können.
Es gibt Eltern, die aufgrund der Brüche in ihrer Biografie entmutigt sind und erst wieder im Arbeitsmarkt und im Leben Fuß fassen können, wenn sie dabei unterstützt werden, ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zurückzugewinnen. Oder Kinder, die verloren sind, wenn kein achtsames Netzwerk früher Hilfen sie auffängt. Die Einforderung von Eigenverantwortung ist leer und hohl, wenn sie nicht mit der erforderlichen Unterstützung verbunden ist, Handlungsoptionen zu erweitern, die ein selbstverantwortetes Leben ermöglichen. Eine Bildungs- und Sozialpolitik, die sich als Politik der Befähigung begreift, stellt sich dieser Herausforderung. Das erfordert viel mehr Kooperation in dem stark zerklüfteten Sozialstaat. Das als entbehrlich gescholtene Bundesfamilienministerium hat viel unternommen, um die dafür notwendige professionelle Neuorientierung der Akteure des Sozialstaats voranzubringen.
Ist eine Sozialpolitik der Befähigung paternalistisch? Laut John Stuart Mill, dem Urvater der liberalen Paternalismuskritik, sind Eingriffe in die individuelle Handlungsfreiheit nur zulässig, wenn es darum geht, eine Schädigung Dritter abzuwehren. So nachzulesen in seiner Schrift On Liberty aus dem Jahr 1859. Es sei nicht die Aufgabe des Staates, Menschen vor sich selbst zu schützen. Aber wäre eine antipaternalistische Radikalkritik mit dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes vereinbar?
Zur Autonomie befähigen und im richtigen Maß paternalistisch sein
Es stimmt, Bildungs- und Sozialpolitik versuchen, Einfluss auf die Lebensentscheidungen von Menschen zu nehmen. Idealiter führt dies zu einer Erweiterung ihrer Handlungsoptio-nen, damit sie ein Leben führen können, das sie wertschätzen. Antipaternalistische Radikal-rhetorik verkennt, dass Menschen nicht immer in ihrem langfristigen Interesse handeln und somit eines gewissen Schutzes bedürfen. Auch in der Mitte der Gesellschaft akzeptieren wir staatlichen Paternalismus, etwa in Form der Verpflichtung zu Krankenversicherung und Al-tersvorsorge. Mit überwältigenden Mehrheiten erteilen Bürgerinnen und Bürger in Wahlen und Umfragen dafür ihre Zustimmung – doch wohl nicht, weil ihnen Autonomie nichts be-deutet, sondern weil sie berechtigte Zweifel hegen, ob sie ganz ohne das Korsett sozialstaat-licher Regelungen, also ohne verpflichtet zu sein, ausreichend vorsorgen würden. Weil das so ist, sollte man den Paternalismusvorbehalt nicht missbrauchen, um nun ausgerechnet am unteren Rand der Gesellschaft soziale Untätigkeit als Respekt vor Autonomie zu rechtfertigen.
Und dennoch muss eine Politik der Befähigung die Autonomie der Bürgerinnen und Bürger respektieren und dort, wo sie Menschen vor sich selbst zu schützen versucht, stets nach dem "Prinzip des schonendsten Paternalismus" handeln, wie dies die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlerin Anne van Aaken formuliert hat. Sie muss stets informieren und aufklären, sonst ist sie manipulativ.
Sozialpolitik ist unverzichtbar für die Teilhabe aller.
Das gilt auch und gerade für Menschen in gefährdeten Lebenslagen. Sie sind nicht nur die Opfer der externen Bedingungen, denen sie ausgesetzt sind. Es gibt Mechanismen der Selbstexklusion und des selbstschädigenden Verhaltens, die aus den jeweiligen Sozialisati-ons- und Lebenserfahrungen heraus zu verstehen sind; aber ändern können sich Menschen nun mal nur selbst. Beraterinnen in sozialen Brennpunkten oder sensibel agierende Fallma-nager in den Jobcentern unterstützen sie dabei.
Wo immer eine Politik der Befähigung ansetzt, sie ist als entscheidendes Element ihrer Wir-kungskette darauf angewiesen, dass Menschen Optionen der Befähigung aufgreifen. Das geht in aller Regel nur gemeinsam mit ihnen. Sie müssen Akteure ihrer Selbstbefähigung werden. Eine Sozial- und Bildungspolitik, die sich dieser Herausforderung stellt, ist nicht Ausdruck eines paternalistischen Nanny-Staates, sondern unverzichtbarer Teil zur Sicherung der Teilhabe aller.